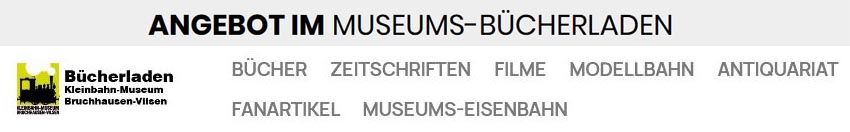Frühzeitig in der Geschichte der deutschen Eisenbahnen wurde schon über Möglichkeiten nachgedacht, den aufwendigen Dampfbetrieb zu vereinfachen oder durch andere Antriebsarten abzulösen. Insbesondere für schwach frequentierte Strecken wurde von der Lokomotivfabrik Borsig schon 1854 ein Dampfwagen hergestellt. Ab 1861 stand mit der Erfindung des Gasmotors durch Lenoir eine erste alternative Kraftquelle zum Dampfantrieb zur Verfügung.
Es dauerte jedoch noch bis 1880, bis die HANOMAG das erste mit Verbrennungsmotor angetriebene Schienenfahrzeug baute. Der erste Triebwagen entstand 1887 durch Gottlieb Daimler. Schwachpunkt dieser frühen Entwicklungen war hauptsächlich die Kraftübertragung. Ein Verbrennungsmotor benötigt gegenüber dem Dampfantrieb eine Kupplung zum Anfahren und Anhalten, sowie ein Schaltgetriebe zum Anpassen der Drehzahl des Motors an die Fahrgeschwindigkeit. Leistungsfähige Getriebe waren in der Anfangszeit noch nicht vorhanden, so daß die Entwicklung der Triebwagen mehr vom Bau von Elektrotriebwagen beeinflußt wurde, deren Herstellung ab 1895 von MAN und den Siemens-Schuckert-Werken eingeleitet wurde.
Der AEG-Triebwagenbau
Seit 1907 werden von der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) in Berlin Verbrennungstriebwagen mit benzol-elektrischem Antrieb hergestellt. Die Motoren stammen dabei von der 1901 übernommenen AEG-Tochter NAG (Neue Automobil-Gesellschaft, ab 1915 Nationale Automobil-Gesellschaft).

Bei den Verbrennungstriebwagen wird mit einem durch den Benzolmotor angetriebenen Generator Strom erzeugt, der dann wie in einem Elektrotriebwagen über Fahrschalter und Vorwiderstände dem Antriebs-Elektromotor zugeführt wird. Eine solche Antriebsform, allerdings mit Dieselmotor kann an der Diesellokomotive V4 des Kleinbahnmuseum Bruchhausen-Vilsen im Betrieb besichtigt werden. Derartige Konstruktionen fielen in der Regel recht schwer aus, was den Einsatz auf vielen Strecken unmöglich machte. Es waren einfachere und leichtere Konstruktionen nötig, um Triebwagen in größeren Stückzahlen verkaufen und bei den potentiellen Kunden - Kleinbahnen mit wenig Verkehrsaufkommen - einsetzen zu können.
Nach dem ersten Weltkrieg mußten in der deutschen Industrie nach Abschluß des Versailler Vertrages neue Wege, neue Produkte als Ersatz für die Rüstungsproduktion gesucht werden. Insbesondere die Deutschen Werke Kiel (DWK), hervorgegangen aus der vormaligen Kaiserlichen Torpedowerkstatt in Kiel, haben mit ihrem 1921 aufgestellten Typenprogramm für benzol-mechanische Triebwagen und den Verkaufserfolgen mit den selbstentwickelten und vollständig selbstgebauten Fahrzeugen und Antrieben die Konkurrenz unter Druck gesetzt.
Bei der AEG sucht man sich 1921 einen Partner für den Triebwagenbau und findet diesen in den Linke-Hofmann-Werken, die ab 1922 nach Übernahme eines Stahl-und Hüttenwerkes als Linke-Hofmann-Lauchhammer AG (LHL) firmieren. In Zusammenarbeit mit LHL wird von der AEG ebenfalls ein Typenprogramm entwickelt für Triebwagen mit benzol-mechanischem Antrieb.

Die Motoren sowie die neuentwickelten Schaltgetriebe, Wendegetriebe und Achsantriebe stammen von der NAG. Zum Einsatz kommen in der Regel Sechszylinder-Motoren mit 75 PS vom Typ Kl 10 z, die der PKW- bzw. LKW-Produktion entstammen.

Die halbautomatischen Schaltgetriebe sind druckluftgesteuert und haben ständig im Eingriff stehende Zahnräder. Geschaltet wird nur über vier Reibungskupplungen, die ein einwandfreies Schalten ermöglichen. Zur Ausführung kommen zwei- und vierachsige Fahrzeuge mit ein oder zwei Antriebsanlagen. Die Verkaufserfolge stellten sich jedoch nicht in den gewünschten Maßen ein, so daß die AEG neue Partner suchte, um in der durch Reparationsleistungen und Inflation geprägten Zeit besser über die Runden zu kommen. Der Partner fand sich in den DWK, dem größten Konkurrenten im Triebwagenbau. 1926 wurde zusammen mit der DWK die Triebwagenbau AG (TAG) mit Sitz in Kiel gegründet, die Partnerschaft mit LHL wurde gelöst und der Triebwagenbau wanderte größtenteils von dem Kölner LHL-Werk nach Kiel. In die TAG brachte die AEG ebenfalls den Getriebebau für Triebwagen der NAG mit ein, die von der DWK/TAG weiterentwickelt und dann in Kiel gefertigt wurden.

Der Erfolg der TAG hält sich ebenfalls in bescheidenem Rahmen, so daß sich die AEG aus dem Triebwagenbau zurückzieht und der DWK die TAG überläßt. Im Jahre 1937 wird die TAG aufgelöst und geht vollständig auf die DWK über. Die AEG-Tochter NAG wird aufgeteilt, die LKW-Produktion wird 1931 von Büssing in Braunschweig übernommen, die PKW-Produktion wird 1934 ganz eingestellt. Der Name NAG lebt noch bis 1950 unter der Firmenbezeichnung Büssing-NAG weiter.
Überlebt haben bis heute die Rechtsnachfolgerin der DWK, die Maschinenbau Kiel GmbH (MaK) in Kiel, sowie die Linke-Hofmann-Busch AG (LHB) in Salzgitter als Nachfolgerin der LHL. Im Zeitraum 1921 bis 1928 wurden unter Regie der AEG 107 Öltriebwagen hergestellt, davon 66 für ausländische Eisenbahnen