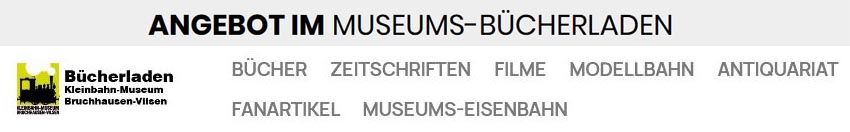Die Entstehungsgeschichte des Lokschuppens
Die Stadt Hoya wurde im Jahre 1881 durch die Hoyaer Eisenbahngesellschaft (HEG) an das Eisenbahnnetz der Preußischen Staatsbahn angeschlossen. So entstand auf der östlichen Weserseite ein Bahnhofsgebäude sowie ein Lokomotivschuppen nebst Werkstatt.
Als im Jahre 1899 die Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf (HSA) gebaut wurde, versuchten die Betreiber der Kleinbahn bereits einen Anschluß an die Hoyaer Eisenbahngesellschaft auf der östlichen Weserseite über die bereits bestehende Straßenbrücke herzustellen. Alle Bemühungen scheiterten jedoch, so daß die Kleinbahn auf der westlichen Weserseite ihren eigenen Bahnhof baute.
Durch die Trennung der Bahnanlagen in Hoya mußten die Fahrgäste lange Fußwege in Kauf nehmen. Sämtliche Frachtgüter in und aus Richtung Eystrup mußten von Hand auf Karren umgeladen und über die Weser gebracht werden. Im Jahre 1907 beschloß die HSA diese geschäftshindernde Anbindung in Hoya zu verbessern und stellte erste Gelder für den Bau eines Gemeinschaftsbahnhofes bereit. Die HEG willigte erst 1908 ein unter der Bedingung, daß die finanziell schwächere HSA den Gemeinschaftsbahnhof einschließlich der Betriebsanlagen für die HEG sowie der Weserbrücke baute und plante.

Es entstand 1911 ein Gemeinschaftsbahnhof mit der HSA, die ein großes Interesse am Anschluß nach Eystrup hatte. Sie war es auch, die die neuen Anlagen der HEG einschließlich der Weserbrücke mit 610.000 Mark zum größten Teil finanzierte. Die HEG bewilligte für den Bau lediglich einen Zuschuß von 40.000 Mark. Die Unterhaltungskosten sollten ebenfalls zum größten Teil bei der HSA liegen, die HEG bezahlte lediglich eine geringe Benutzungsgebühr.
Die normalspurigen Gleisanlagen der HEG konnten nicht auf dem selben Höhenniveau der schmalspurigen Anlagen gebaut werden, da in diesem Falle die Rampe zur höher liegenden Weserbrücke zu steil geworden wäre. Sie lagen höher als die der HSA und wurden durch eine lange Rampe mit ihnen verbunden. So wurde auch der HEG-Lokschuppen auf einem Niveau von 2,55 m über dem umliegenden Gelände errichtet. Da der frisch aufgeschüttete Bahndamm für ein Gebäude nicht tragfähig war, mußte der Lokschuppen auf 2,55 m hohen Grundmauern auf dem alten Untergrund errichtet werden. Die Gruben entstanden auf einer aufwendigen Gewölbekonstruktion in 1,2 m Höhe. Der Bahndamm wurde erst nachträglich angeschüttet.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Bahndamm wurde der Lokschuppen mit einer Drehscheibe an die Gleisanlagen angeschlossen. Zwar benötigten die von der HEG eingesetzten Dampftriebwagen eine Drehscheibe, jedoch entschloß sich die HEG 1912 den Lokomotivbetrieb mit zwei gebrauchten Dampfloks einzuführen. Im Jahre 1914 wurde eine dritte, diesmal neue, Dampflok beschafft. Die beiden Dampftriebwagen wurden 1914 an die Kleinbahn Celle-Wittingen verkauft.

Nutzungen und Umbauten des Gebäudes
Ursprüngliche Nutzung
Der Lokschuppen wurde zweigleisig ausgeführt mit Platz für maximal drei Lokomotiven oder zwei Triebwagen. Die Anordnung der Rauchabzüge läßt erkennen, daß ursprünglich ein Dampftriebwagen und eine Dampflok oder zwei Dampfloks gleichzeitig angeheizt werden konnten. Im hinteren Bereich lag durch eine Mauer abgetrennt die Schmiede, die auch Werkstatteinrichtungen erhielt. Durch ein Tor in der Trennwand konnten auf dem durchgeführten Gleis Achsen oder Kessel in die Schmiede gefahren werden. An der Seitenwand war ein Magazinraum und ein Aufenthaltsraum für das Lokpersonal eingebaut. Diese beiden Räume waren unterkellert. Ein kleiner Anbau an der Stirnseite beherbergte einen Wasserbehälter und den Brunnen. Die Lokomotiven mußten sich das Wasser sehr wahrscheinlich mit einem Pulsometer in den Wasserbehälter pumpen.
Umkleideräume oder Waschräume waren nicht vorhanden, die Arbeiter mußten sich zu Hause waschen und umziehen.
Zeichnung des HEG-Lokschuppen in Hoya 1912
Grundriss vom HEG-Lokschuppen in Hoya 1912